|
|
| Staatsoper Hamburg |
19.10.2006 |
|

© Staatsoper Hamburg |
 |
In jeder guten Stimme fÃĪrben sich Lebenserfahrungen ab.
Annedore Cordes: ÂŧSimon BoccanegraÂŦ lag Verdi zeitlebens am Herzen und wird von Kennern auÃerordentlich geschÃĪtzt. Trotzdem konnte sich diese Oper auf den SpielplÃĪnen nicht so durchsetzen wie etwa ÂŧLa TraviataÂŦ, ÂŧRigolettoÂŦ oder ÂŧOtelloÂŦ. Dabei bewegt sie sich in ihrer Thematik und Anlage durchaus innerhalb des Verdischen Stoffrahmens. Wie erklÃĪren Sie sich diesen Sachverhalt?
Franz Grundheber: Diese Oper ist fÞr das breite Publikum von der Thematik her zu bedrÞckend und zu dÞster. Auch die Orchesterfarben sind extrem dunkel getÃķnt. AuÃer dem Finale des ersten Aktes gibt es kaum dramatische HÃķhepunkte; und es gibt keine Arien fÞr den Titelhelden, sondern nur die wunderbare Ansprache in der Ratsszene. Es sind keine wirklich brillanten Partien in dieser Oper, nicht einmal fÞr den Tenor. Das Hauptanliegen dieses Werkes konzentriert sich ganz auf das Schicksal Simon Boccanegras. In dieser Hinsicht ist es ein von aller Belcanto-Seligkeit ÂŧbefreitesÂŦ modernes Operndrama.
ÂŧDem âšBoccanegraâđ fehlt es an Theatralik! In der âšForzaâđ sind die Partien gemacht, im âšBoccanegraâđ sind sie alle zu machen!ÂŦ Wie beurteilen Sie diese Aussage Verdis? Geben Sie dem Komponisten Recht?
Er hat ja noch viel mehr darÞber geschrieben, unter anderem, dass die Titelpartie viel schwerer zu singen wÃĪre als Rigoletto, was natÞrlich vom Stimmtechnischen her nicht wahr ist. Die Partie des Simon muss gefÞllt werden mit Menschlichkeit und mit Wahrhaftigkeit. Sie ist eine der wenigen Rollen, die Þberhaupt kein Opernpathos vertragen, wie auch das Werk insgesamt nicht mit dem Þblichen Pathos der Oper behaftet ist. Wenn man zum Beispiel einen Giorgio Germont gestaltet, ist Pathos bereits durch die Handlung vorgegeben, weil er es gezielt einsetzen wird bei Violetta Valery und natÞrlich bei seinem Sohn Alfredo, den er zur RÞckkehr bewegen mÃķchte. Amonasro aus ÂŧAidaÂŦ wiederum ist jemand, der mit BrutalitÃĪt und allen erdenklichen Tricks arbeitet; diese Rolle vertrÃĪgt somit auch das Opernpathos, ebenso Jago im ÂŧOtelloÂŦ. Rigoletto schlieÃlich ist eine Figur, die schon durch die kÃķrperliche Missbildung extrem gezeichnet ist, seine Auftritte vermitteln immer eine pathetische Ãbersteigerung der Situation. Ganz anders Simon Boccanegra. Diese Rolle verlangt eine NatÞrlichkeit und eine Menschlichkeit, die extrem schwer auf der BÞhne darzustellen ist. Dass man als SÃĪnger nicht eine einzige aufgesetzte Geste liefert, sondern sich auf das beschrÃĪnken muss, was aus dem Inneren kommt, das sind die Anforderungen dieser Partie. Es gibt wenige Figuren in der Opernliteratur, die man so angehen sollte â sonst nur den Wozzeck und natÞrlich auch den Barak. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass mir diese drei Rollen besonders am Herzen liegen.
Spielen fÞr Sie auch persÃķnliche Erfahrungen eine Rolle bei der Gestaltung dieser Figur?
Ja, natÞrlich. Mathieu Ahlersmeyer riet mir einst davon ab, vor dem vierzigsten Lebensjahr das schwere deutsche und italienische Fach zu singen. Er sagte: ÂŧWenn Sie dann Mitte FÞnfzig sind, die Stimme intakt ist und Sie etwas wissen vom Leben, dann kÃķnnen Sie auch den Simon Boccanegra singen. Sie wissen dann, was Tod bedeutet â Ihre Eltern sind, wenn Sie 55 sind, meistens schon gestorben. Sie haben vielleicht eine gescheiterte Ehe hinter sich, Sie haben ein krankes Kind oder ein behindertes Kind, oder Sie haben andere SchicksalsschlÃĪge erlebt. In jeder guten Stimme fÃĪrben sich diese Lebenserfahrungen ab. Und deswegen sollte man so eine Rolle nicht mit einem 37-JÃĪhrigen besetzen. Einen Posa kann man mit einem jÞngeren Mann besetzen, nicht aber einen Simon Boccanegra.ÂŦ
Was bedeutet die Hamburger ÂŧBoccanegraÂŦ-Produktion fÞr Sie?
Diese Inszenierung war fÞr mich ein selten beglÞckendes Erlebnis. Aus verschiedenen GrÞnden: zunÃĪchst einmal natÞrlich, weil ich an der Hamburgischen Staatsoper vor vierzig Jahren begonnen habe und mich hier zu Hause fÞhle. Es ist so etwas wie ein krÃķnender Abschluss, diese Rolle, die ich vorher in Hamburg noch nie gesungen habe, auch hier nun zu prÃĪsentieren. Es gab eine Art VerschwÃķrung zwischen Simone Young und mir, denn auf ihre Frage, welche Engagements ich mir wÞnschen wÞrde, antwortete ich: Die Oper, in der am Ende des Prologs die ganze BÞhne singt: Vivat Simon! Vielleicht war das der Grund, dass sie es gemacht hat, aber ich glaube eher nicht, denn es war auch fÞr sie ein groÃes Anliegen, diese Oper herauszubringen. Zum anderen war die szenische Arbeit mit Claus Guth extrem beglÞckend. Er hat ein klares Konzept und inszeniert sehr behutsam. Dabei lieà er mir die Zeit und Ruhe, die Figur aus meinem Inneren heraus zu entwickeln â und nicht Þber ÃuÃerlichkeiten.
Was sind die Besonderheiten der Hamburger Inszenierung?
Die Inszenierung beginnt mit Simons letzter Stunde und erzÃĪhlt die Geschichte mit Hilfe von Doubles aus der Retrospektive. Als ich von den Doubles erfuhr, war ich zunÃĪchst skeptisch, aber jemand, der auf sein eigenes Leben zurÞckschaut, sieht sich eben auch selbst im Playback. Das Wechselspiel zwischen Beobachtung und dem Eingreifen in die Handlung prÃĪgt die gesamte Produktion und fÞhrt stringent zum HÃķhepunkt im ersten Finale, wenn Simon glaubt, durch das Wiederfinden seiner Tochter und die Erfahrung von Liebe mit einem Mal alle Probleme lÃķsen zu kÃķnnen, gegen die er zwanzig Jahre vergeblich gekÃĪmpft hat. Und es sieht tatsÃĪchlich bestens aus, wÃĪre da nicht die Verurteilung von Paolo. Diese Verurteilung â man ahnt es schon â wird ihn im zweiten Teil umbringen, da dieser Mann sich nicht so einfach beiseite schieben lÃĪsst.
Entscheidend ist auch der erste Auftritt des Simon nach der Pause, nachdem bereits die Geschehnisse des ersten Finales ad absurdum gefÞhrt worden sind. Simon glaubte Gabriele Adorno trauen zu kÃķnnen und zeigte ihm seine Zuneigung, indem er ihm sagte: Behalte deine Waffe. Und jetzt hÃĪlt er ein Schreiben in den HÃĪnden, das beweist, dass alles umsonst war, dass Adorno wieder in eine Intrige gegen ihn verwickelt ist. Die tiefe Depression, die ihn dann befÃĪllt, lÃĪsst ihn bis zum Ende nicht mehr los â Simone Young drÞckt dies Þbrigens ergreifend in einer extremen Verlangsamung dieses kleinen Vorspiels vor dem ersten Auftritt aus. Von diesem Moment an befindet sich Simons Stern im Sinkflug bis zum Ende der Oper, bis zu seinem Tod. Diese Resignation ist es eigentlich, die ihn umbringt, weniger das von Paolo verabreichte Gift. Es ist das Gift des Hasses und die Einsicht in die UnmÃķglichkeit, mit Liebe und VersÃķhnung etwas erreichen zu kÃķnnen. Das ist bis heute aktuell. Man braucht ja nur einmal auf die LÃĪnder dieser Erde vom Balkan bis nach PalÃĪstina, Libanon und Israel zu schauen.
[Tab]Wahrscheinlich habe ich mich in dieser Inszenierung wirklich total mit der Figur identifiziert, denn ein oder zwei Kritiker meinten nach der Premiere, dass ich die ungeheure brillante Kraftentfaltung, die ich im ersten Akt hatte, im zweiten Teil der Oper nicht mehr durchgehalten hÃĪtte.
Dass die Zeit an Ihrer Stimme spurlos vorbeigegangen zu sein scheint, dass sie frisch und intakt klingt: Hat das mit der klugen Auswahl Ihrer Partien zu tun?
Es gibt viele Faktoren. Durch meine Lehrerin Margaret Harshaw in Bloomington, wo ich studierte, lernte ich entscheidende Dinge Þber Technik und Þber die Behandlung meiner Stimme. Sie brachte mir bei, an meine Arbeit analytisch heranzugehen, zum Beispiel herauszufinden, welche Rollen gut fÞr mich sind und welche nicht. Ich erlebe immer wieder junge SÃĪnger, die sagen: NatÞrlich kann ich Pizarro singen, das ist doch viel einfacher als ein Germont. Ohne Frage, mit der jugendlichen Kraft kann ich einen Pizarro brÞllen. Aber diese Partie sollte man Þberhaupt erst angehen, wenn man einen Germont technisch bewÃĪltigt hat. Ich habe frÞh gelernt, mir Rollen auszusuchen, die den VorzÞgen meiner Stimme gerecht werden. Angebote von Herbert von Karajan fÞr Telramund und Pizarro lehnte ich ab. Da er mir jedoch ein zweites Mal einen Vertrag fÞr Pizarro anbot, mit der Zusicherung, zwei Jahre vorher den Scarpia bei ihm zu singen, habe ich gedacht: in Ordnung, wir werden sehen, was in vier oder fÞnf Jahren ist, wenn der Pizarro ansteht. Ich sang also Scarpia in Salzburg, was damals sowohl fÞr meine Entwicklung als auch fÞr mein Renommee sehr wichtig war. Und weitere zweieinhalb Jahre spÃĪter starb Karajan. Nun brauchte ich den Pizarro-Vertrag nicht mehr zu erfÞllen. Ich habe diese Rolle und auch den Telramund nie gesungen. Diese Entscheidung war sicher einer der GrÞnde, warum sich meine Stimme so gut gehalten hat; hinzu kommt, dass ich mich von vornherein gegen Ãberbelastungen gewehrt habe. Meine Lehrerin sagte, man darf nur einmal am Tag volle Pulle singen. Wenn man morgens und abends eine Orchesterprobe singen soll â die kann man nicht markieren â, dann sollte man das ablehnen, weil die Stimme auf diese Art und Weise geschÃĪdigt wird. NatÞrlich bestimmen auch die genetischen Anlagen und die Gesundheit darÞber, wie lang eine SÃĪngerlaufbahn ist. Und man braucht auch eine gewisse QualitÃĪt, um zu Þberleben.
Sie singen seit 40 Jahren regelmÃĪÃig an der Staatsoper Hamburg und haben viele Ihrer wichtigsten Partien hier gesungen, insgesamt waren es 123 verschiedene Rollen âĶ
âĶ und darunter waren gut die HÃĪlfte erste Fachpartien! NatÞrlich gab es auch viele kleinere Rollen â ich habe allein zehn UrauffÞhrungen mitgemacht. 1966, wÃĪhrend der ersten Intendanz Rolf Liebermanns, wurde ich an die Staatsoper engagiert. Das war noch die groÃe Zeit des Ensembles, wo wir ein- oder zweimal im Jahr Festliche Opernwochen hatten. Dann kamen die groÃen auslÃĪndischen SÃĪnger, Italiener wie Mario del Monaco und Tito Gobbi. Ansonsten hatten wir 75 SÃĪnger fest verpflichtet im Ensemble. Ich kann allein zehn Baritone aufzÃĪhlen, mit denen ich zusammen engagiert war. NatÞrlich musste man unter diesen Vorzeichen auch die wirklich kleinen Partien singen, obgleich ich zu der Zeit schon Figaro, Masetto oder Schaunard gestaltete. Aber wenn ich den Herold im ÂŧOtelloÂŦ Þbernahm, dann bemÞhte ich mich, selbst aus dieser Mini-Rolle etwas Besonderes zu machen. Bei diesem Modell bestand jedenfalls nie die Gefahr, dass man Þberfordert wÞrde. Man hatte zwar immer das GefÞhl, es geht zu langsam, man kommt nicht schnell genug voran, man kÃķnnte doch viel mehr. Aber es war genau das Richtige.
Wie haben Sie die VerÃĪnderungen am Hause im Laufe der Jahre erlebt? Gab es in Hamburg Menschen, Situationen, die Sie als KÞnstler und als Mensch besonders geprÃĪgt haben?
Als Liebermann ging, lÃķste sich das Ensemblemodell auf. Das fing schon mit Everding an und wurde bei DohnÃĄnyi fortgesetzt. War man fest am Haus engagiert, wurde es schwierig, sich kÞnstlerisch weiterzuentwickeln, da die Premieren stets mit international renommierten GÃĪsten besetzt wurden und man selber dann eben die Partien wÃĪhrend der Repertoirevorstellungen, meistens ohne BÞhnen- und Orchesterproben, Þbernehmen musste.
Anfang der achtziger Jahre gab GÃĐrard Mortier sein Amt als KÞnstlerischer Betriebsdirektor in Hamburg auf und holte mich dann sowohl fÞr meinen ersten Mandryka als auch fÞr meinen ersten Macbeth an die Pariser Oper. Auch in BrÞssel, wo er anschlieÃend die Intendanz Þbernahm, setzte er mich in mehreren Neuinszenierungen ein, sowohl im italienischen als auch im schwereren deutschen Fach. Dies geschah zu dem Zeitpunkt, als ich eben die Vierzig Þberschritten hatte, genau an jenem Wendepunkt also, den Mathieu Ahlersmeyer mir beschrieben hatte.
Das war eigentlich die entscheidende Erkenntnis und VerÃĪnderung: Ich erarbeitete danach nur noch in Neuinszenierungen neue Rollen. So bekam ich Urlaub fÞr meinen ersten Amfortas in Bordeaux, fÞr meinen ersten HollÃĪnder in Rouen â Neuproduktionen mit entsprechenden szenischen und musikalischen Proben. Das war ein entscheidender Schritt.
Sie haben in dieser Zeit Ihren Festvertrag in Hamburg von sich aus aufgegeben âĶ
Ich bin nach zwanzig Jahren gegangen, obwohl ich schon unkÞndbar war. Rolf Liebermann machte mir in seiner zweiten Amtszeit (1984â88) dann noch ein ganz tolles Angebot fÞr einen Festvertrag. Aber ich hatte inzwischen gesehen, was UnkÞndbarkeit an einem groÃen Haus wie Hamburg oder wo auch immer bedeuten kann. ZwangslÃĪufig muss man da erleben, dass jÞngere SÃĪnger aufgebaut werden und man den alten in die Ecke stellt. Schon mancher gestandene EnsemblesÃĪnger wurde spÃĪter zurÞckversetzt ins kleinere Fach. Und ich sah, wie viele dieser Kollegen deprimiert waren, wie sie auch die Lust verloren, an sich und an ihrer Stimme zu arbeiten und wie die StimmqualitÃĪt dann in kÞrzester Zeit radikal nachlieÃ, weil sie sich sagten: Die setzen mich ohnehin nicht mehr ein. Ich habe mir damals geschworen, dass ich derlei nicht erleben will. Mein Ziel war stets zu singen, weil man mich haben wollte, nicht, weil ich beschÃĪftigt werden musste. Deshalb musste ich kÞndigen. Ãbrigens entwickelte sich meine internationale Karriere danach besser als je zuvor: durch die Arbeit mit Karajan und auch durch die Angebote, die ich aus Wien bekam, von Claudio Abbado und Claus Helmut Drese etwa, die mich fÞr den Wozzeck und fÞr verschiedene andere Sachen an die Staatsoper holten. Auch dessen Nachfolger Ioan Hollender verschaffte mir in Wien eine fantastische BeschÃĪftigungslage. Der Erfolg mit ÂŧSimon BoccanegraÂŦ in MÞnchen wiederum Ãķffnete mir am Covent Garden die Tore. Und die dortige Produktion ÂŧFrau ohne SchattenÂŦ wurde spÃĪter in Los Angeles gegeben. Dann trat ich Þberall in Amerika auf. Ich habe an der MET Rigoletto gesungen und Wozzeck. Ich habe in Chicago regelmÃĪÃig gastiert, in San Francisco, Los Angeles, Houston, Philadelphia. So lÃĪuft das dann manchmal, und da ist es natÞrlich leicht zu sagen: Ja, ich verzichte auf das Ensemble, auf die UnkÞndbarkeit. NatÞrlich blieb Hamburg mein Stammhaus, und ich bekam dann zunÃĪchst durch die Initiative von Peter Ruzicka und spÃĪter durch die nachfolgenden Intendanten weiterhin GastvertrÃĪge in Hamburg.
Gibt es besondere Projekte, die Sie fÞr die Zukunft planen?
Ende dieses Jahres, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, will ich ein Liedprogramm erarbeiten. Nach einer AuffÞhrungsserie von ÂŧMoses und AronÂŦ gebe ich in Wien nÃĪchstes FrÞhjahr einen Liederabend. Das hat mich zwar immer fasziniert, Angebote hatte ich aber bisher stets abgelehnt. Denn ich fand, dass ich es im Zusammenhang mit meinen Opernauftritten nicht machen sollte â das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Ich vergleiche es mit einem bildenden KÞnstler, der sechs oder acht Wochen am Marmor arbeitet und anschlieÃend nicht mehr die feinen Linien zeichnen kann. Er braucht erst Zeit, um die Muskulatur seiner HÃĪnde umzustellen. Und so ist es beim Singen auch. Denn die kleine Form des Liederabends kann dazu fÞhren, dass man die groÃe Form der Oper nicht mehr richtig beherrscht. Des Weiteren werde ich in meiner Heimatstadt Trier ÂŧWozzeckÂŦ singen und zum ersten Mal inszenieren. Ich arbeite dort seit vielen Jahren immer wieder und bin bekannt als âšder Trierer, der eine Weltkarriere gemacht hatâđ. GMD und Intendant des Theaters und sogar der langjÃĪhrige OberbÞrgermeister, den ich sehr gut kenne, trugen dieses Anliegen an mich heran. Letzterer wÞnschte sich diese AuffÞhrung fÞr sein Abschiedsjahr. Ich mache das eigentlich nur, weil mir die Oper ÂŧWozzeckÂŦ und die Stadt Trier ganz besonders am Herzen liegen.
Quelle: Staatsoper Hamburg, "Journal", Oktober, November, Dezember 06/07, Ausgabe 2 |
|
 |
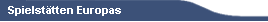 |
 |
|
| Praha (Prag), Staatsoper |
|
| © Praha (Prag), Staatsoper Prag |
|

