|
|
| Opernhaus ZĂĽrich |
24.02.2007 |
|

© Marlies Henke

© Marco Borggreve |
 |
Die Zauberflöte: Meisterwerk oder Machwerk, Märchen oder Mysterium
Meisterwerk oder Machwerk, Märchen oder Mysterium: Mozarts «Zauberflöte» ist nicht nur die beliebteste Oper des Komponisten, sondern auch diejenige, die am häufigsten für Diskussionen gesorgt hat und bis heute Rätsel aufgibt. Am 17. Febraur hat die Neuinszenierung am Opernhaus Zürich Premiere. Ein Gespräch über die Arbeit an Mozarts letzter Oper mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt und Regisseur Martin Kušej.
Herr Harnoncourt, Sie haben bereits zwei Inszenierungen der «Zauberflöte» musikalisch geleitet, eine davon war die Inszenierung von Jean-Pierre Ponnelle hier am Opernhaus 1986; von dieser Aufführung gibt es auch einen CD-Mitschnitt. Sie suchen sich Ihre Projekte sehr genau aus; was also hat Sie bewogen, Mozarts letzte Oper jetzt am Opernhaus Zürich neu einzustudieren?
Nikolaus Harnoncourt: Ich bin vom Opernhaus angefragt worden, ob ich eine neue «Zauberflöte» machen würde. Jetzt interessiert es mich mehr und mehr, weil mich der späte Mozart interessiert, der eigentlich kaum anknüpft an seine früheren Werke. Das habe ich zum ersten Mal ganz deutlich gesehen beim Requiem, aber es ist auch erkennbar bei «Titus» und beim Klarinettenkonzert, also bei all diesen Werken, die er in seinem letzten Lebensjahr geschrieben hat. Da ist für mich interessant, wie er weiter komponiert hätte; er hätte ja noch leicht zugleich mit Mendelssohn komponieren können. Mich fasziniert die zunehmende Vereinfachung, wie sein Werk immer auf den Punkt geht und nur durch Textverteilung und wenige raffinierte harmonische Dinge ganz viel aussagt.
Sie haben einmal gesagt, die «Zauberflöte» sei eine romantische Komposition zu nennen; warum?
Nikolaus Harnoncourt: Ich finde das im Ansatz schon bei «Idomeneo». Es ist in erster Linie klanglich, der Einsatz der Klarinetten und die Mischung von Klarinetten und Hörnern, das ist eine romantische Mischung. Wie sehr das damals schon so empfunden worden ist, kann man daran sehen, dass die früheren Mozart-Sinfonien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer statt mit Oboen mit Klarinetten aufgeführt worden sind.
Emanuel Schikaneder, der Schauspieler, Theaterdirektor und Autor war, schrieb das Libretto zur «Zauberflöte» – und wurde dafür viel gescholten; man hat ihm vorgeworfen, ein heilloses Konglomerat aus Märchen, Vorstadtposse, Maschinentheater und Freimaurer-Ideologie geschaffen zu haben. Wie beurteilen Sie das Libretto?
Nikolaus Harnoncourt: Ich finde das Libretto sehr interessant. Und ich finde, wir machen es uns sehr leicht. Ich kenne das von ganz vielen Opern, dass man sagt: wunderbare Musik, blöder Text. Das ist das erste, was jemand sagt, der ein Stück nicht versteht. Ein Mozart komponiert keinen blöden Text. Ich gehe dann davon aus, dass eher der, der das sagt, blöd ist. Die grossen Komponisten haben alle mit Librettisten zusammengearbeitet, Monteverdi war Tür an Tür mit seinen Librettisten, bei Mozart ist es bekannt, bei Beethoven weiss man, wie der gesucht hat nach Librettisten und wie er sogar den Grillparzer als Librettisten abgelehnt hat. Für ihn war der «Fidelio», der ja auch dieses Urteil ständig bekommt, ein ideales Libretto. Schumann war ein Komponist, der eine Zeit lang nicht gewusst hat, ob er mehr Dichter oder mehr Komponist ist, und hat diese «Genoveva» von Hebbel und von Tieck gefunden; heute sagt man auch hier: blöder Text, gute Musik.
Martin Kušej, wie beurteilen Sie als Regisseur Schikaneders Libretto?
Martin Kušej: Wenn man sich mit einem Stück auseinandersetzt, dann muss man den Text zunächst einmal ernst nehmen. So auch bei Schikaneders «Zauberflöten»-Libretto. Sonst kann man sich die Arbeit ja gleich sparen. Man muss genügend Stellen finden, die interessant und noch nicht bis aufs letzte ausgeleuchtet sind und die einem auch helfen oder erklären, wie man mit den Szenen umzugehen hat, was vielleicht im Hintergrund gemeint war. Natürlich gibt es auch Passagen, die überhaupt nicht logisch sind und an denen der Fortgang der Handlung nicht logisch zu begründen ist. Gerade das muss man dann zu einer Qualität machen. Und letztendlich muss man schauen, wie das auf der Bühne praktisch funktioniert. Gewisse Dinge kann man heute so einfach nicht mehr sagen, weil es völlig altmodisch und blöd und verstaubt klingt. Da greift man dann ein.
Also muss man den Text von Schikaneder behutsam modernisieren?
Martin Kušej: Behutsam muss nicht sein, man muss einfach schauen – und da fühle ich mich Schikaneder und Mozart verwandt –, was in der Praxis funktioniert, was einen Effekt gibt. Ich mache es genauso wie sie – man kann ja nicht so tun, als wäre Theater sakrosankt, es war immer lebendig, jeder hat etwas verändert, geklaut, umgestellt.
Man könnte auch komplett neue Dialoge schreiben, wie es in der Vergangenheit auch schon passiert ist. Aber Sie gehen zunächst einmal mit dem Vorhandenen um.
Martin Kušej: Ja, das ist die Grundvoraussetzung.
Was interessiert Sie an dieser Oper?
Martin Kušej: Das kann ich besser über das beschreiben, was mich nicht interessiert, und das ist die Freimaurer-Ideologie, alles, was mit Ägypten zu tun hat und auch die Aufklärung. Einerseits gibt es natürlich richtige und wichtige Erkenntnisse dieser Idee, aber erstens bin ich der Meinung, dass schon Mozart die Bruchstellen und die Verwerfungen der Aufklärung erkannt hat, oder eben genau das, wo es einfach aus dem Ruder gelaufen ist. Zweitens können wir nicht so tun, als wäre alles gut ausgegangen, und als würden wir viel besser dastehen als 1791.
Einer der Gründe, warum man Schikaneder vorwirft, das Libretto der «Zauberflöte» sei ein «Machwerk», ist der so genannte Bruch am Ende des Ersten Aktes. Tamino hat von der Königin der Nacht erfahren, dass ihre Tochter, Pamina, von Sarastro, dem Bösewicht, geraubt wurde und zieht nun aus, um sie zu retten. In Sarastros Reich angekommen, muss er aber feststellen, dass dieser als weiser Herrscher gilt. Einige Wissenschaftler glauben, dass Mozart und Schikaneder mitten in der Entstehung des Stückes die Richtung gewechselt und ihren Plan geändert hätten, weil zur gleichen Zeit ein ähnlicher Stoff vertont und mit grossem Erfolg aufgeführt worden war. Empfinden Sie auch diesen vieldiskutierten Bruch in der «Zauberflöte»?
Martin Kušej: Für mich geht es hier weniger um einen Bruch als um einen Perspektivwechsel – ein und dieselbe Person wird aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Aber wie wir zum Beispiel bei der Hallenarie gesehen haben, ist es wahnsinnig interessant, dass Sarastro selbst sich als gut oder edel oder humanistisch darstellt. Das ist ein absolut schlüssiges Argument, er würde sich ja nicht als Schurke darstellen wollen in dieser Situation. Das ist schon interessant, dass man sich auf einer so grundsätzlichen narrativen Ebene schon mal mit einer Irritation auseinandersetzen muss, die die damals eingebaut haben. Was den Bruch betrifft: Wenn schon einer da ist, dann finde ich, dass die Figur von Pamina ab diesem Moment, also Ende des ersten Aktes, sehr massiv in die Handlung eingreift und eine Art von tatsächlicher Utopie oder das Prinzip von Liebe vertritt und zeigt und lebt. Da fängt für mich die Oper an, richtig interessant zu werden.
Nikolaus Harnoncourt: Ich habe diesen Bruch nie empfunden. Wissenschaftler kennen ein Element, das die Wissenschaft sehr leicht verfälscht, und das ist die Entdeckerfreude. Wenn man meint, irgendetwas gefunden zu haben, dann versucht man, alles dem anzupassen, und dann entstehen manchmal ganz tolle Missverständnisse. Dass die Königin der Nacht einmal als liebende Mutter dargestellt wird und das andere Mal als Bestie, das entspricht ganz genau der Psychologie: es zeigt, wie ein Mensch aus seinem inneren Kreis beurteilt wird und wie er von aussen beurteilt wird. Dass Mozart und Schikaneder die Königin der Nacht eine Rachearie singen lassen, heisst ja nicht, dass sie so ist, sondern dass sie so gesehen werden muss. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es ganz toll, dass eine Person derart vielschichtig gezeigt wird.
In unserer Aufführung gibt es ja auch nicht zwei Welten – also das Reich Sarastros und das der Königin der Nacht –, die aufeinander prallen.
Martin Kušej: Nein, für uns ist das eine Welt, in der es eben Tag und Nacht gibt...
Nikolaus Harnoncourt: ...und Licht und Dunkel!
Martin Kušej: Wenn Welten aufeinander prallen, dann ist das auf gewisse Art und Weise der Ursprung von Theater überhaupt. Mir ist es aber zu einfach, wenn man sagt, dass im Stück selber die Welten aufeinander prallen. Es prallt vielmehr unsere heutige, jetzige Welt auf die Welt des Stückes. Aber wenn wir darüber reden, dass die Königin der Nacht im Dunkeln lebt und deshalb eine weisse Figur ist, dass Leute in dem Stück nichts sehen, also schwarz sehen, obwohl sie in der weissen Welt unterwegs sind, dass jemand sich sehr weiss darstellt, obwohl er vielleicht etwas Dunkles zu verbergen hat, dass ein schwarzer Mensch von der Liebe zu einer Weissen träumt, dann sind das sehr interessante Aspekte von einem sehr einfachen Schema.
Zu den ganz grossen Qualitäten von Mozarts Opern gehört, dass er seine Figuren nie denunziert und dass sie nie schwarz und weiss gezeichnet sind; das gilt auch für die «Zauberflöte» – auch die Königin der Nacht und Sarastro sind ja nicht eindeutig «gut» oder «böse».
Martin Kušej: Eindeutigkeit interessiert mich auch gar nicht, es müssen immer Assoziationen in verschiedene Richtungen möglich bleiben. Tamino sieht in der Königin der Nacht die Mutter seiner Braut, aber vielleicht auch seine eigene Mutter, oder eine ältere Geliebte. Da schwingt auf jeden Fall auch etwas Erotisches mit. Ähnlich ist es mit Pamina und Sarastro. Und wenn die Königin der Nacht ihre Rache-Arie singt, dann ist das für Pamina ein regelrechter Angsttraum.
Nikolaus Harnoncourt: Mozart scheint sogar das wirklich Böse überhaupt nicht zu gelingen, oder er will es gar nicht ausdrücken, weil er sich gänzlich identifiziert mit seinen Figuren. Eine Verbrecherfigur ersten Ranges wie Don Giovanni wird von den Hörern geliebt. Die Seiten, die Mozart bei seinen Figuren aufdeckt, sind eben menschlich. Bei der «Zauberflöte» ist das so krass, dass man verschiedene Figuren erst mal überhaupt nicht versteht. Bei Sarastro stolpert man auf Schritt und Tritt darüber, dass er so grandiose, gute Sachen redet wie keine andere Figur Mozarts. Das Charakterbild, das er von sich selbst entwirft, ist makellos wunderbar. Aber kurz vorher hat er Monostatos, der zwar ein Verbrecher ist, mit bitterster Ironie verurteilt. Das ist nicht der weise Richter, der hier sein Urteil spricht, sondern Sarastro will Monostatos ganz sadistisch blossstellen. Wenn man dann noch sieht, wie sich die anderen Menschen in Sarastros Umkreis verhalten: der Sprecher schreckt Tamino damit, dass Pamina möglicherweise schon tot ist, und es wird dauernd damit gespielt, dass man irgendwelche Prüfungen gar nicht bestehen kann…
Es wird in Kauf genommen, dass Tamino und Papageno dabei sterben könnten.
Nikolaus Harnoncourt: Dieses Stück hat irgendwas vom österreichischen Kasperltheater an sich: das Krokodil frisst die Figuren. Die krasseste, makaber-lustigste Kasperl-Szene ist die, wenn die beiden Priester von den Weibertücken sprechen. Da weiss ich gar nicht, ob nicht der Sinn dieser Szene vielleicht der ist, dass die Priester plötzlich Mitleid kriegen mit Tamino und denken, den müssen wir jetzt ein bisschen aufheitern und die Schrecken dieser ganzen Szenerie der «Eingeweihten» so karikieren und übertreiben, dass er lachen muss.
[Die «Eingeweihten» um Sarastro, die ja oft als Freimaurer interpretiert worden sind, sind ein ziemlich frauenfeindlicher und kein besonders sympathischer Kreis.
Nikolaus Harnoncourt: Ja, wie eben solche abgeschlossenen Gesellschaften, die niemanden reinlassen wollen und die ihre eigenen Schweinereien unter sich halten wollen. Solche reinen Männer- und vielleicht auch reinen Frauengesellschaften gibt es ja schon ganz lange. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Vortrag gehalten bei einer Freimaurer-Loge in Wien, da durfte gerade mal eine Sekretärin mitschreiben, was gesprochen wurde. Nie im Leben hätten Frauen da hinein gedurft. Vereine und Gruppierungen und Gesellschaften, da entsteht eben Vereinsmeierei… Ich finde ja nicht nur, dass Schikaneder das beschreibt, sondern ich finde auch, er beschreibt diese Aura, die damals gross in Mode war mit den ägyptischen Riten und der Freimaurerei. Für Mozart war das ein gefundenes Fressen, da ging es nicht mehr um korrekte Details der Gruppierungen, sondern darum, dass diese abgeschlossenen Gesellschaften richtig auf die Schaufel genommen werden. Fast immer, wenn von den «Eingeweihten» die Rede ist, spürt man ein hohles Pathos, wo die Hörer drüber lachen sollen und denken: das möchte ich gar nicht wissen, was in diesen abgeschlossenen Kreisen so geredet wird.
In unserer Aufführung wird das Rätselhafte, Unlogische, Märchenhafte der Geschichte auch dadurch betont, dass das Ganze eine besondere Situation als Rahmen bekommt.
Martin Kušej: Die Geschichte spielt sich in dem Moment ab, in dem Tamino und Pamina sich den Hochzeitskuss geben – die beiden werden in diesem besonderen Moment noch einmal durch die Welt ihrer Ängste, Erwartungen und Zwänge geschickt.
In der «Zauberflöte» ist jede Figur auf ganz eigene Weise gezeichnet – Papagenos Arien sind im volksliedhaften Ton gehalten, die Königin der Nacht singt zwei äusserst virtuose Koloraturen-Arien, und Tamino und Pamina stimmen einen ernsten und empfindsamen Ton an. Mit welchen Mitteln schafft Mozart hier für jede Figur eine ganz eigene Klangsphäre?
Nikolaus Harnoncourt: Bei der Königin der Nacht zeigt er einem wieder einmal, dass Koloraturen nicht einfach Virtuosität sind, an der man sich freut, sondern dass die Koloratur wirklich einen ganz hohen Ausdruck hat. Das ist sehr schwer zu realisieren, es gibt nicht viele Sängerinnen, die das können – dass nämlich diese koloraturartigen Tonwiederholungen sehr aggressiv sein müssen und dass jeder Ton wie ein Pfeil sein muss in Paminas Herz. Es ist völlig klar, dass er diese Klangsprache keiner anderen Figur geben konnte. Die anderen Sphären hat er auch mit der Instrumentation sehr deutlich gemacht. Mit der Erfindung der Bassetthörner – und das geht wieder ganz stark in die Romantik – wird in Kombination mit Hörnern und Fagotten ein Klang möglich, der völlig neu ist in der Musik. Mit dieser Klangwolke charakterisiert Mozart die Welt der Eingeweihten. Das ist ein piano-Klang, man konnte offenbar auf diesen Instrumenten, wie sie damals waren, nicht wirklich laut spielen, da entsteht so ein geheimnisvoller, magischer Klang. Im ersten Akt wird das noch zurückgehalten, der Sprecher vertritt zwar die Eingeweihten, aber er macht mir nicht den Eindruck, als würde er diese Sphäre wirklich vertreten, er hat eher den Charakter eines Schweizer Polizisten, also absolut unerbittlich. Der Sprecher ist ein bedingungsloser Parteigänger von Sarastro, und an dem rennt sich ein Emotionsmensch wie Tamino wirklich den Kopf ein. Bei Papageno gibt es, wie schon gesagt, viele Elemente aus der Volksmusik, sogar das Stahlspiel findet man in Salzburg heute noch im Wirtshaus an der Wand angenagelt. Auch die Flöte, die Papageno spielt, ist in manchen Ländern noch bis heute in Verwendung. Siese Instrumente verwendet Mozart sehr folkloristisch. Man weiss nicht: ist Papageno Mensch oder Tier oder etwas dazwischen oder eine volkstümliche Spiegelung von Tamino. Er kriegt jedenfalls einen völlig eigenen Klang.
Martin Kušej: Ich sehe Papageno als traumhaften, unzivilisierten Doppelgänger von Tamino. Er ist der eigentliche Sympathieträger in diesem Stück. Aber nicht auf dieser banalen Ebene – ein Tölpel, der nichts auf die Reihe kriegt –, sondern für mich ist es derjenige, der – Gott sei Dank – diesen Domestizierungsversuchen der so genannten Eingeweihten ganz naiv standhält und irgendwie auch seine Linie beibehält und wohl den wichtigen emotionalen und ungerichteten Teil des Mensch repräsentiert. Der ist tatsächlich immer der Sympathischere. Ich will ja gar nicht sagen, dass alle Facetten dieser Pädagogik falsch wären; sicher muss man auch mal geduldig sein und auch mal mutig an die Wirrnisse des Lebens herangehen. Wenn es allerdings dogmatisch wird und menschenverachtend, dann schlägt mein Herz eher für Papageno.
Nikolaus Harnoncourt: Tamino wird ja so überkultiviert dargestellt, dass er nicht einmal Mut hat. Dort, wo sein Mut gefordert wäre, am Anfang, bei der Schlange, fängt es ja schon an, da heisst sein erstes Wort «zu Hilfe», und in den grossen Proben am Ende des Stückes führt ihn Pamina. Er ist ein Antiheld. Die Figur, die er in der Bildnis-Arie singt, das grosse Intervall mit der darauf folgenden Skala nach unten, charakterisiert ihn wahrscheinlich am meisten. Diese Figur benutzt Pamina bei dem Wiedersehen, wenn sie singt: «Tamino mein», und wandelt sie um in eine Liebesfigur. Und bei Pamina selbst muss man einiges wissen, dass man ihr musikalisch gerecht wird. Die Aufführungstradition ist eine schwere Belastung bei diesem Stück. Schon 1815 gibt es Berichte von Musikern und Komponisten, die sagen, das Stück ist ganz anders geworden, vor allem, was Pamina betrifft. Denn Pamina – und das hat sicher zu tun mit der Romantik – ist ganz bald zu einer grossen Tragödin gemacht worden, das kann sie nicht gewesen sein bei Mozart. Die Sängerin der Uraufführung war 17 oder 18 Jahre alt, die kann diese Art von Tragödin nicht spielen. Wenn man sich die Arie genau anschaut, dann stellt man fest, dass sie dasselbe Tempo hat wie die Rosenarie im «Figaro». Dann ist sie plötzlich nicht mehr eine traurige Arie, sondern eine zornige. Dieses junge Mädchen ist zornig und verzeifelt, weil ihr Geliebter nicht mit ihr sprechen will. Die ganzen harten Dissonanzen und die Tonartwechsel, die hier vorkommen, und dieses wilde synkopische Nachspiel, das alles bekommt plötzlich einen ganz anderen Sinn. Ich kenne diese Arie auch nur als traurige Arie. Aber wenn Mozart das gewollt hätte, hätte er niemals Andante 6/8 geschrieben. Denn er hat schon Andantino vorgeschrieben für das Duett Papageno-Pamina, das heisst, dieses Duett ist ein bisschen langsamer, weil Andantino in Mozarts Zeit langsamer war als Andante. Und Mozart irrt sich nicht, er schreibt keine falschen Tempi. Eenn, dann ist unsere Auffassung falsch. Schon 25 Jahre nach der Uraufführung gab es Leute, die sich aufregten über die Entstellung der Pamina in die Richtung traurig und tragisch und sagten, sie wäre zu einer langweiligen Figur geworden.
Mit den lange überlieferten Hörgewohnheiten zu brechen, ist sicher sehr schwierig, und zwar sowohl in Bezug auf das Publikum, als auch in Bezug auf die Ausführenden.
Nikolaus Harnoncourt: Wenn ich jetzt das Tempo nehme, von dem ich überzeugt bin, dass es das Tempo von Mozart ist, dann weiss ich schon heute, dass es Reaktionen geben wird, dass ich immer alles anders mache. Aber wenn sich dann einmal eine solche Auffassung durchgesetzt hat, dann kann man auch nicht mehr zu den falschen Hörgewohnheiten zurück. In den letzten 50 Jahren habe ich sehr viele Sachen gefunden, die immer zuerst bekämpft worden sind, und jetzt machen es alle, manche sogar noch extremer als ich.
Wie arbeiten Sie denn mit Sängern und Orchester, um das Stück von der jahrhundertealten Rezeptionsgeschichte freizulegen?
Nikolaus Harnoncourt: Wenn der Sänger des Tamino gut ist, dann hat er schon hundert- oder zweihundertmal den Tamino gesungen, und das sind in jedem Fall grosse Erlebnisse. Und die Musiker, die das spielen, spielen ja die «Zauberflöte» praktisch von dem Moment an, in dem sie ins Orchester eingetreten sind. Das ist schon schwer. Ich kann nur sagen: Wir denken das Stück jetzt neu.
Was machen Sie selbst heute anders als vor zwanzig Jahren?
Nikolaus Harnoncourt: Das kann ich nicht so genau festmachen, weil ich das nicht überprüfe. Aber ich würde mich schämen, wenn ich in den letzten zwanzig Jahren nicht gescheiter geworden wäre.
Glauben Sie an die Utopie der Liebe in diesem StĂĽck?
Nikolaus Harnoncourt: Ja, an das muss man glauben. Das beginnt mit dem Zeigen des Bildnis von Pamina, ja es fängt eigentlich schon damit an, wie die drei Damen auf Tamino reagieren, es geht dann weiter damit, wie die Königin der Nacht und Tamino aufeinander reagieren, und das zieht sich durch das ganze Stück.
Aber Tamino und Pamina, das eigentliche Liebespaar der «Zauberflöte», sieht man fast nie zusammen, und das einzige Liebesduett singt Pamina mit dem falschen Partner, nämlich mit Papageno.
Nikolaus Harnoncourt: Ja, und das hat in diesem Moment auch gar keinen Bezug zur Handlung. Sie sagen auch nicht «ich» und «du», sondern «bei Männern, welche», es ist fast eie ein Seminar über die Liebe in einer Universität. Und gerade von diesen beiden, vom grossen Naivling Papageno und vom seine erste Liebe möglicherweise bald verspürenden Kind Pamina, denn so sehe ich die Pamina.
Martin Kušej: Die erste Begegnung von Pamina und Papageno ist eine Stelle, an der das Libretto richtig gut wird. Papageno spricht hier nicht in der Ich-, sondern in der Wir-Form: «Wir sind hier, um dir tausend schöne und angenehme Sachen zu sagen, dich in unsere Arme zu nehmen...»; vorher gerät er ins Stocken, verliebt sich auch ein bisschen in Pamina und sagt dann: «Wo blieb ich denn? Richtig, bei der Liebe». Auch Pamina empfindet Zuneigung zu dieser anderen Seite von Tamino, vielleicht sogar mehr als zu Tamino selbst.
Herr Harnoncourt, Sie haben sich Martin Kušej als Regisseur für dieses Stück gewünscht. Warum?
Nikolaus Harnoncourt: Weil er unbefangen und neu an eine Sache herangeht. Wenn er zu einem Stück keinen Zugang findet, dann macht er es nicht. Wenn er ihn findet, dann ist er offen für jede Idee, und er geht immer mit mir vorher die ganze Sache musikalisch durch und bekommt dann Ideen. Es ist ja nicht damit getan, dass man ein Stück aus der Mozart-Zeit genauso aufführt wie damals. Wir spielen für die heutigen Menschen, und wenn die Botschaft eines Stückes zeitgebunden wäre, dann sollte man es heute überhaupt nicht mehr aufführen. Aber ich finde eben, dass bei allen Werken Mozarts die Botschaft völlig zeitlos ist, und dass man nur den Schlüssel finden muss.
Was ist die Botschaft der «Zauberflöte»?
Nikolaus Harnoncourt: Liebe, Liebe, Liebe.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Aus: Opernhaus Magazin, Opernhaus ZĂĽrich, Nr. 8 Spielzeit 2006/2007, Spielplan bis 18. Mai 2007, Opernballausgabe |
|
 |
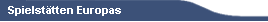 |
 |
|
| Kosice, Staatstheater |
|
| © Staatstheater, Kosice |
|

